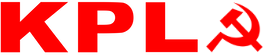»Bommeleeër«, gestern und heute
Vor 40 Jahren befand sich Luxemburg gerade inmitten einer Serie von 18 Bombenanschlägen, die das Land in den Jahren 1984 bis 1986 erschütterten.
Noch während der Serie von Terroranschlägen auf Strommasten, technische Einrichtungen des Flughafens Findel, die Olympische Sporthalle, die Straßenbauverwaltung und den Justizpalast gab es die Erkenntnis, dass es sich beim »Bommeleeër« nur um eine größere Gruppe von Männern mit militärischer Erfahrung, großem Insiderwissen und Unterstützung mit bis in die höchsten Ränge von Gendarmerie, Polizei, Armee und Geheimdienst handeln könnte.
Zu dieser Schlußfolgerung kamen damals bereits der kommunistische Abgeordnete René Urbany und der Rechtsanwalt Gaston Vogel, die sich intensiv mit der Frage der Auftraggeber der Terroranschläge beschäftigten und selbst eine Beteiligung von Militärs und Geheimdienstlern von NATO-Staaten nicht ausschlossen – eine Spur, die nie ernsthaft verfolgt wurde.
Bevor der »Bommeleeër«-Prozeß vor mehr als zehn Jahren, im Juli 2014 an seinem 177. Verhandlungstag ausgesetzt wurde, saßen ganze 2(!) ehemalige Mitglieder der der Brigade Mobile der Gendarmerie, Marc Scheer und Jos Wilmes, auf der Anklagebank. Sie waren wohl das, was man ein Bauernopfer nennt, und es gilt keineswegs als sicher, ob das Strafverfahren gegen sie nicht doch noch eingestellt wird, wenn der »Bommeleeër«-Prozeß demnächst wieder aufgerollt wird.
In einem zweiten Strafverfahren sollen acht Verdächtige wegen Falschaussage unter Eid während des vorangegangenen Bombenleger-Prozesses belangt werden, unter ihnen die fünf ehemaligen Führungskräfte von Gendarmerie und Polizei, Charles Bourg, Aloyse Harpes, Pierre Reuland, Armand Schockweiler und Guy Stebens, die zuvor noch der vorsätzlichen Verhinderung der Bestrafung von Straftätern angeklagt waren.
Es liegt uns fern, Spekulationen darüber anstellen zu wollen, ob es in der Bombenlegeraffäre irgendwann doch noch einer Verurteilung von mutmaßlichen Tätern kommen oder es »faute de combattants« irgendwann zur Einstellung des Verfahrens kommen wird.
Die Hintermänner dürften allerdings weiterhin im Dunkeln bleiben in dieser »Staatsaffäre«, denn jeglicher Geheimnisverrat auf dieser Ebene könnte selbst Jahrzehnte später noch ein Erdbeben auslösen. Hinzu kommt, dass es sich bei den Terroranschlägen in Luxemburg nicht um »einzigartige« Geschehnisse in der damaligen Zeit handelte, denn in einer ganzen Reihe von europäischen NATO-Staaten fanden zu jenem Zeitpunkt noch weitaus blutigere Bomben- und Terroranschläge statt. Sie waren Teil der von den Geheimdiensten der USA und der europäischen NATO-Staaten entwickelten »Stategie der Spannung«, dazu gedacht, der Friedensbewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Bevölkerung von der »Notwendigkeit« einer massiven Aufrüstung und Militarisierung nach innen und nach außen zu »überzeugen«.
Im Gegensatz zu damals bedarf es heute ganz offensichtlich keines »Bommeleeër«, um Rekordaufrüstungsprojekte zu legitimieren, Dutzende gepanzerte Fahrzeuge, Militärflugzeuge, Spionagesatelliten und weiteres militärisches Teufelszeug anzuschaffen. Die Friedensbewegung hat den schleichenden Rechtsruck in den Parteien und in der Gesellschaft und die anhaltenden ideologischen Flächenbombardierungen, die auf einen nächsten Krieg vorbereiten sollten, nicht überlebt.
Das zu ändern, ist eine schwierige Herausforderung, der sich die verbleibenden fortschrittlichen politischen und gewerkschaftlichen Kräfte stellen müssen. Denn es ist niemand anders da, der ihnen diese schwierige Aufgabe abnehmen wird.